Bericht von Larissa Wilwert über ihren Archivaufenthalt bei der Fondazione di Studi Storici „Filippo Turati“ (Florenz).

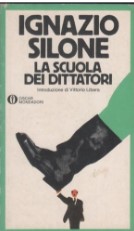
Vom 31. März bis zum 5. April 2025 ging es für mich nach Florenz, wo ich dank einer Einzelförderung durch die Heimann-Stiftung den Nachlass des italienischen Schriftstellers, Essayisten und Politikers Ignazio Silone (Pseudonym von Secondino Tranquilli) sichten durfte. Im Rahmen meines komparatistischen Promotionsprojekts, in dem ich mich mit der besonderen Form des autonomen literarischen Dialogs zwischen 1890 und 1950 befasse, stellt Silone in gewisser Hinsicht die Mittlerfigur zwischen den italienischen, französischen und deutschsprachigen (Kon-)Texten dar: Als italienischer politischer Emigrant publizierte er 1938 in Zürich seine ursprünglich auf Italienisch verfasste und dann ins Deutsche übersetze Dialogsammlung Die Schule der Diktatoren, die zeitgleich in englischer Übersetzung als The School of Dictators sowohl bei Harpers and Brothers in New York als auch beim Londoner Verlag Jonathan Cape erschien. 1939 kam mit La escuela de los dictadores eine spanisch-argentinische Version hinzu, während die französische Übersetzung bis nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf sich warten ließ. Erst in den 1960er Jahren wurde die Scuola dei dittatori in überarbeiteter Form auch einem breiten italienischen Publikum zugänglich.
Larissa Wilwert
Bei der Sichtung des nachgelassenen Briefwechsels der 1930er Jahre in der Fondazione di Studi Storici „Filippo Turati“ überraschte mich, mit welcher sprachlichen Selbstverständlichkeit sich Silone in einem internationalen Kontext zu etablieren versuchte, indem er seine Briefkontakte nicht nur auf Italienisch und Deutsch pflegte, sondern auch auf Französisch, Englisch und Spanisch. Besonders interessierten mich dabei natürlich die Kommentare zu seiner Dialogsammlung, die ich sowohl in den zahlreichen Rezensionen der englisch-amerikanischen, deutschen sowie französischen Presse fand, als auch in den intensiven Briefwechseln mit Bernard von Brentano, Siegfried Kracauer, Elisabeth („Medi“) Mann und ihrem späteren Ehemann Giuseppe Antonio Borgese. Dabei stellte sich heraus, dass die Leser wohl Schwierigkeiten hatten, die für die Scuola dei dittatori zentrale Spannung zwischen satirischer Menschheitsdarstellung und pädagogischer Belehrung auszuhalten. Zugleich wurde in zahlreichen Kommentaren Kritik an der hybriden Form des Dialogs geübt, indem besonders die Tatsache getadelt wurde, „dass da die Tradition gebrochen ist“ (Fritz Brupbacher). Die Ergebnisse des Forschungsaufenthaltes stellen für mich den Ausgangspunkt dar, um der Bedeutung des Dialogs innerhalb der europäischen Exilliteratur zwischen 1930 und 1950 noch einmal intensiver nachzugehen und nach einem möglichen (autobiographisch motivierten) Gattungswandel zu fragen.
Mein aufrichtiger Dank gilt der Heimann-Stiftung für die äußerst freundliche Unterstützung meines Forschungsaufenthaltes sowie der Fondazione di Studi Storici „Filippo Turati“ für die organisatorisch einwandfreie Bereitstellung der Archivmaterialien.